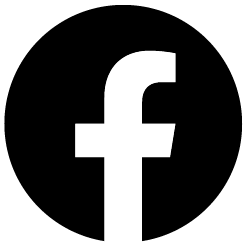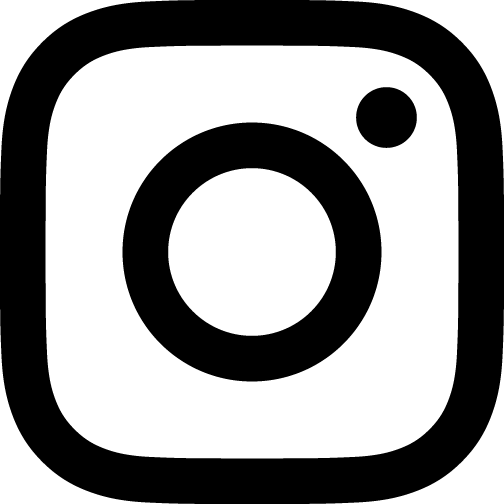The Bewitched Bee
John Baldessari, Karl Blossfeldt, Igor Chelkovski, Dieter Hiesserer, Chema Madoz, Duane Michals, Francesca Woodman
22 June – 07 August 2018
„Bitte verstehen Sie mich nicht zu schnell.“ André Gide
Im Satz ist ein Punkt das Ende. Kann er auch ein Anfang sein? Ja, darauf können sich alle ausgestellten Künstler einigen. Denn ein Punkt kann vieles: Er kann ein Loch sein, die zweidimensionale Ansicht einer Kugel, eine Scheibe, eine Sonne, ein Schatten. Und ein bedrohtes Satzzeichen, denn kaum eine mobile Kommunikation endet noch mit einem Punkt. Ein Punkt kann auch von Dauer sein, die englische Übersetzung period deutet es an. Und aus der Mathematik wissen wir, dass ein Punkt immer auch ein Kreis ist.
Duane Michaels (*1932), dessen Serie der Ausstellung den Titel gibt, sagt über seine Fotografie, dass es in ihr nicht um Antworten, sondern um Fragen geht. In der langen Sequenz „The Bewitched Bee“ (1986), eine Nacherzählung des Mythos’ von Diana und Actaeon, in der Diana auffällig fehlt, sprießen einem nackten jungen Mann nach einem Bienenstich Geweihe, er wandert in den Wald „auf der Suche nach Liebe“ und ertrinkt in einem Blättermeer.
Michaels geht es nie darum, die Fotografie als Medium des Sichtbaren zu nutzen. Was ihn mit den fotografischen Positionen von Baldessari, Madoz und Hiesserer verbindet, ist die Konzentration auf das Unsichtbare. Was unsichtbar wurde, ist der Rohstoff der dreizehnteiligen Sequenz, die den klassischen griechische Mythos der Metamorphose mit selbstgeschriebenen Texten anreichert, nicht notwendigerweise um das Gesehene zu beschreiben, sondern um der lyrischen Grundposition eine materielle Basis zu geben. Auf die Frage, warum er handschriftlichen Text in seine Bilder einbezieht, antwortete er: „Ich liebe die Intimität der Hand. Es ist so, als würde man jemandem zuhören.“
Eine der Konstanten von Michaels‘ Œuvre ist seine Vorliebe für intime Bildformate, deren Oberflächen Berührungsreize setzen. Diese Arbeiten mit ihren universellen Themen der Erinnerung, der Träume, der Begierde und der Sterblichkeit, ziehen den Betrachter näher heran und bestehen auf seinem vollen Engagement auf einer nicht nur emotionalen Ebene. Denn jede Aussage, so lehrt uns Michaels – und erst recht jeder Blick – muss auf seine erkenntnistheoretische Basis hin geprüft werden. Wer redet da? Weshalb redet er oder sie? Und von welcher Basis her? Hat der Redende, Betrachtende, Schauende bedacht, dass er vielleicht letztlich nur das sehen kann, was ihm seine eigenen Erkenntnisorgane vermitteln? Dass jeder Blick auf etwas zunächst einmal ein Blick auf das eigene Selbst ist? Dass wir nur das sehen, was wir auch sehen können? Dass also in jedem Sehen und Schauen ein Zirkel besteht? Und dass vielleicht nicht ich das Bild eines nackten Mannes anschaue, sondern der nackte Mann – über sein Bild – mich? Auch als Sehender entkommt man sich nicht.
Der Typ, der Punkte auf Gesichter macht. So kennt man John Baldessari (*1931), und so ist er auch in der Ausstellung präsent. Doch sind wie immer die Punkte nicht gleich Punkte. Angefangen hat er mit Preisschildern, die er nahm, um die konventionellen Bilder der Nachrichtenpresse in ihrer Konventionalität auszustellen. Er hatte schon zu viele Aufstellungen von Lokalpolitikern gesehen, zu viele Einweihungsbänder, die durchgeschnitten wurden, zu viele Séparées mit sich zuprostender Prominenz. Er ersetzte die immer gleichen Gesichter durch Farbkreise, um der Austauschbarkeit der Szenarien eine spielerische Komponente zu geben. Aber er ging noch weiter:
Das gezeigte Diptychon, die zwei sich gegenüberstehenden Reiter in schwarz-weiß und der Vogel sind Filmstills. Baldessari, ein großer Bewunderer Jean-Luc Godards, hat die Kreise, die er auf die Gesichter der Reiter applizierte, ebenfalls gegenübergestellt: Rot und Grün sind Komplementärkontraste, weil sie im Farbkreis entgegengesetzt sind. Als Komplementärkontraste bilden sie das Nachbild der jeweils anderen Farbe, wirken nebeneinanderplatziert konstruktiv, aber nie farbig und – was hier von besonderer Relevanz ist – löschen sich gegenseitig aus, wenn sie miteinander gemischt werden. Zwar bringen unbunte Umgebungen, insbesondere Schwarz, bunte Farben stärker zum Leuchten, wenn Rot und Grün allerdings gemischt werden, ergibt sich wieder ein neutrales Grauschwarz. Ein Zuviel an Farbe wirkt farblos.
Diese farbtheoretische Brisanz auszudeuten, überließ Baldessari schon immer gern Anderen. Wenn es aber einen roten Faden in seinem Œuvre gibt, dann ist es das geduldige Angehen gegen Klischees, gegen die verklärenden Geschichten, die wir uns oftmals unhinterfragt selbst erzählen.
Die Komplementärkontraste nimmt Igor Chelkovski (*1937) in seinen Werken auf und gibt ihnen ein Fundament: Farbige Holzlatten sind mit Öl und Email lackiert aneinander montiert worden, sie bilden die Strophen eines skulpturalen Gedichts, das seine Rhythmik aus Farben, Längen und Oberflächen erhält. So ordnen die Beziehungen der Farben auch die Räumlichkeiten, da das Aufeinandertreffen der Farbzonen sie automatisch in ein Vor und Zurück sortiert. Der Raum wird somit auch eine Funktion der Farbe. Er ist nicht mehr imitativ, sondern imaginativ.
Im Gedicht zieht man sich in der Sprache hinter die Sprache zurück. Hier zieht sich Chelkovski im Material hinter das Material zurück und nutzt Holz als Anker, aber nicht als Grund für Realität. Die Farben, sorgsam mal matt mal glänzend lackiert, sind die Rhythmen, die Stimmung, mit Sternen durchsetzt. Und wie ein Gedicht ist das Holz mit Realität verwandt, ihr aber keinesfalls Untertan.
Auf das Zuviel der Bilder haben Künstler schon seit vielen Jahrzehnten mit Collagen reagiert. Auch Dieter Hiesserer (*1939) ist ein Künstler, dem es weniger um die Darstellung, als um die Mitteilung von Welt geht, wenn er in den Fotocollagen sichtbare Schnitte zulässt und das Eingreifen als Geste ausstellt. Seine Arrangements sind aber alles andere als zufällig: Die Blüte, die aus der ausgeschnittenen Hülse ragt, welche einen schmalen Schatten wirft, setzt im Kern die organische Logik von Wachsen und Werden außer Kraft. Es gibt keinen Grund, keine Basis der blütenreinen Knospe, ein Schatten bleibt, aber Einflussname sieht anders aus. NO LOGIC IN ART, wie er selbst formulierte.
Diese schwebenden, surrealen Anordnungen reagieren im Raum mit den Arbeiten von Chema Madoz (*1958). Der spanische Fotosurrealist arrangiert seine minimalistischen schwarz-weißen Kompositionen immer als optische Illusion. Als Spiel der Flächen, wie bei der Pik 5, die knorrige Zweige aus den Kartenspielsymbolen ausbildet. Schon im holländischen 17. Jahrhundert gab es die Bildgattung der „bedriegertje“, der Bildtäuschungen, die Irritation als Sehschule nutzten. Madoz ergänzt Didaktik mit Poetik: Fotografie war einmal der sichtbare, bleibende Ausdruck des besonderen Moments, des Augenblicks, der sich als Gegenwelt behaupten musste gegenüber dem Alltag, in den sich das Besondere nicht integrieren ließ. Die Fotografie als eine der Realität versprochene Kunstform wird hier völlig dysfunktional: Madoz’ Fotografien sind ohne Titel, was an sich schon ein Paradox ist. Er sagt selbst, dass er vor seinen „Bildern stehen und fühlen möchte, dass ich mit ihnen kommunizieren kann.“ Diese Kommunikation – an Magritte und Man Ray geschult – kann man sich voller Humor vorstellen, in der das Imaginierte des Gedichts, das Unausgesprochene, visuell übersetzt wird. Denn nicht von ungefähr ist die Pik 5 beim Kartenlegen die Karte des Betrugs.
Karl Blossfelds (1865–1932) Kreise sind Blüten: Er hatte um 1900 damit begonnen, Vergrößerungen von Blättern anzufertigen, außerdem fotografierte er Stiele, Samen und Hülsen, um die Analogie von Natur- und künstlerischen Formen aufzuzeigen. Jenseits jeglicher naturwissenschaftlicher Dokumentationspflicht ist das Buch „Urformen der Kunst“ (1928), dem die Blätter entnommen wurden, vor allem durch die gewissenhafte Lichtführung, die Rahmung und Sequenzierung ausgezeichnet. Monatelang suchte Blossfeldt nach Pflanzen, die seiner formalen Vorstellung entsprachen, so dass man ihn zum ersten Vertreter einer ‚skulpturalen Fotografie’ zählen kann. Und so scheinen wir nicht auf Pflanzenteile zu blicken, sondern auf architektonische Details: Fialen, Schlusssteine, Konsolen, Brüstungen, Türknäufe, die in Holz oder Metall ausgeführt sein konnten, erinnern weniger an die Bauhausprinzipien als an die Architektur des Jugendstils. Blossfeldts Hang zur Halbabstraktion verbindet ihn mit den surrealen Fotografien von Chema Madoz, während die botanische Grundlage seiner Arbeiten mit den Collagen Dieter Hiesserers korrespondiert, wobei Leichtigkeit kein Darstellungsziel der Arbeiten war.
Wie eine installative Antwort auf Karl Blossfeldts Pflanzenstudien wirkt die Arbeit von Francesca Woodman (1958–1981), die verschiedene Reproduktionen von Vögeln auf einer Fotografie versammelt. Selbst ebenfalls ein aufzeichnendes Medium, ist die Fotografie nun eine weitere Stufe der Darstellbarkeit, die zwischen fixiert und gezeichnet, zwischen subjektiver Aneignung und mathematischer Präzision changiert.
Ihre Hand, ihr Schatten werden zum Teil der Arbeit, als gesichtsloser Gegenstand, als Teil des unpersönlichen Raumes und doch als Zeichen dafür, dass hier gezeigt wird, gezeigt werden soll und gleichzeitig die Grenze des Zeigens thematisiert wird.
Durch ein stetiges Schwanken zwischen An- und Abwesenheit, das sie und die Objekte selbst nie wirklich greifbar, aber immer zum Thema macht, zeigt sich ihre Nähe zu den fragilen Identitäten der surrealistischen Fotografien Claude Cahuns. Die Fotografie wird zum Schauplatz unheimlicher Erscheinungen: Was man dort sieht, ist niemals ganz lebendig, aber auch nie ganz tot.
Die Ausstellung deutet an, dass Kunst neben aller Politisierung das tun darf und soll, was sie am besten kann: auf das zu schauen zu hören, was andere als unsichtbar erachten, die unbeachteten Phänomene des Alltäglichen zu rhythmisieren und ihnen eine eigene Poesie zuzuerkennen. Auch eine Biene, so haben jüngste Untersuchungen nachgewiesen, kann das Konzept der Zahl Null verstehen.
Dr. Anja Schürmann
John Baldessari, Karl Blossfeldt, Igor Chelkovski, Dieter Hiesserer, Chema Madoz, Duane Michals, Francesca Woodman
22 June – 07 August 2018
„Bitte verstehen Sie mich nicht zu schnell.“ André Gide
Im Satz ist ein Punkt das Ende. Kann er auch ein Anfang sein? Ja, darauf können sich alle ausgestellten Künstler einigen. Denn ein Punkt kann vieles: Er kann ein Loch sein, die zweidimensionale Ansicht einer Kugel, eine Scheibe, eine Sonne, ein Schatten. Und ein bedrohtes Satzzeichen, denn kaum eine mobile Kommunikation endet noch mit einem Punkt. Ein Punkt kann auch von Dauer sein, die englische Übersetzung period deutet es an. Und aus der Mathematik wissen wir, dass ein Punkt immer auch ein Kreis ist.
Duane Michaels (*1932), dessen Serie der Ausstellung den Titel gibt, sagt über seine Fotografie, dass es in ihr nicht um Antworten, sondern um Fragen geht. In der langen Sequenz „The Bewitched Bee“ (1986), eine Nacherzählung des Mythos’ von Diana und Actaeon, in der Diana auffällig fehlt, sprießen einem nackten jungen Mann nach einem Bienenstich Geweihe, er wandert in den Wald „auf der Suche nach Liebe“ und ertrinkt in einem Blättermeer.
Michaels geht es nie darum, die Fotografie als Medium des Sichtbaren zu nutzen. Was ihn mit den fotografischen Positionen von Baldessari, Madoz und Hiesserer verbindet, ist die Konzentration auf das Unsichtbare. Was unsichtbar wurde, ist der Rohstoff der dreizehnteiligen Sequenz, die den klassischen griechische Mythos der Metamorphose mit selbstgeschriebenen Texten anreichert, nicht notwendigerweise um das Gesehene zu beschreiben, sondern um der lyrischen Grundposition eine materielle Basis zu geben. Auf die Frage, warum er handschriftlichen Text in seine Bilder einbezieht, antwortete er: „Ich liebe die Intimität der Hand. Es ist so, als würde man jemandem zuhören.“
Eine der Konstanten von Michaels‘ Œuvre ist seine Vorliebe für intime Bildformate, deren Oberflächen Berührungsreize setzen. Diese Arbeiten mit ihren universellen Themen der Erinnerung, der Träume, der Begierde und der Sterblichkeit, ziehen den Betrachter näher heran und bestehen auf seinem vollen Engagement auf einer nicht nur emotionalen Ebene. Denn jede Aussage, so lehrt uns Michaels – und erst recht jeder Blick – muss auf seine erkenntnistheoretische Basis hin geprüft werden. Wer redet da? Weshalb redet er oder sie? Und von welcher Basis her? Hat der Redende, Betrachtende, Schauende bedacht, dass er vielleicht letztlich nur das sehen kann, was ihm seine eigenen Erkenntnisorgane vermitteln? Dass jeder Blick auf etwas zunächst einmal ein Blick auf das eigene Selbst ist? Dass wir nur das sehen, was wir auch sehen können? Dass also in jedem Sehen und Schauen ein Zirkel besteht? Und dass vielleicht nicht ich das Bild eines nackten Mannes anschaue, sondern der nackte Mann – über sein Bild – mich? Auch als Sehender entkommt man sich nicht.
Der Typ, der Punkte auf Gesichter macht. So kennt man John Baldessari (*1931), und so ist er auch in der Ausstellung präsent. Doch sind wie immer die Punkte nicht gleich Punkte. Angefangen hat er mit Preisschildern, die er nahm, um die konventionellen Bilder der Nachrichtenpresse in ihrer Konventionalität auszustellen. Er hatte schon zu viele Aufstellungen von Lokalpolitikern gesehen, zu viele Einweihungsbänder, die durchgeschnitten wurden, zu viele Séparées mit sich zuprostender Prominenz. Er ersetzte die immer gleichen Gesichter durch Farbkreise, um der Austauschbarkeit der Szenarien eine spielerische Komponente zu geben. Aber er ging noch weiter:
Das gezeigte Diptychon, die zwei sich gegenüberstehenden Reiter in schwarz-weiß und der Vogel sind Filmstills. Baldessari, ein großer Bewunderer Jean-Luc Godards, hat die Kreise, die er auf die Gesichter der Reiter applizierte, ebenfalls gegenübergestellt: Rot und Grün sind Komplementärkontraste, weil sie im Farbkreis entgegengesetzt sind. Als Komplementärkontraste bilden sie das Nachbild der jeweils anderen Farbe, wirken nebeneinanderplatziert konstruktiv, aber nie farbig und – was hier von besonderer Relevanz ist – löschen sich gegenseitig aus, wenn sie miteinander gemischt werden. Zwar bringen unbunte Umgebungen, insbesondere Schwarz, bunte Farben stärker zum Leuchten, wenn Rot und Grün allerdings gemischt werden, ergibt sich wieder ein neutrales Grauschwarz. Ein Zuviel an Farbe wirkt farblos.
Diese farbtheoretische Brisanz auszudeuten, überließ Baldessari schon immer gern Anderen. Wenn es aber einen roten Faden in seinem Œuvre gibt, dann ist es das geduldige Angehen gegen Klischees, gegen die verklärenden Geschichten, die wir uns oftmals unhinterfragt selbst erzählen.
Die Komplementärkontraste nimmt Igor Chelkovski (*1937) in seinen Werken auf und gibt ihnen ein Fundament: Farbige Holzlatten sind mit Öl und Email lackiert aneinander montiert worden, sie bilden die Strophen eines skulpturalen Gedichts, das seine Rhythmik aus Farben, Längen und Oberflächen erhält. So ordnen die Beziehungen der Farben auch die Räumlichkeiten, da das Aufeinandertreffen der Farbzonen sie automatisch in ein Vor und Zurück sortiert. Der Raum wird somit auch eine Funktion der Farbe. Er ist nicht mehr imitativ, sondern imaginativ.
Im Gedicht zieht man sich in der Sprache hinter die Sprache zurück. Hier zieht sich Chelkovski im Material hinter das Material zurück und nutzt Holz als Anker, aber nicht als Grund für Realität. Die Farben, sorgsam mal matt mal glänzend lackiert, sind die Rhythmen, die Stimmung, mit Sternen durchsetzt. Und wie ein Gedicht ist das Holz mit Realität verwandt, ihr aber keinesfalls Untertan.
Auf das Zuviel der Bilder haben Künstler schon seit vielen Jahrzehnten mit Collagen reagiert. Auch Dieter Hiesserer (*1939) ist ein Künstler, dem es weniger um die Darstellung, als um die Mitteilung von Welt geht, wenn er in den Fotocollagen sichtbare Schnitte zulässt und das Eingreifen als Geste ausstellt. Seine Arrangements sind aber alles andere als zufällig: Die Blüte, die aus der ausgeschnittenen Hülse ragt, welche einen schmalen Schatten wirft, setzt im Kern die organische Logik von Wachsen und Werden außer Kraft. Es gibt keinen Grund, keine Basis der blütenreinen Knospe, ein Schatten bleibt, aber Einflussname sieht anders aus. NO LOGIC IN ART, wie er selbst formulierte.
Diese schwebenden, surrealen Anordnungen reagieren im Raum mit den Arbeiten von Chema Madoz (*1958). Der spanische Fotosurrealist arrangiert seine minimalistischen schwarz-weißen Kompositionen immer als optische Illusion. Als Spiel der Flächen, wie bei der Pik 5, die knorrige Zweige aus den Kartenspielsymbolen ausbildet. Schon im holländischen 17. Jahrhundert gab es die Bildgattung der „bedriegertje“, der Bildtäuschungen, die Irritation als Sehschule nutzten. Madoz ergänzt Didaktik mit Poetik: Fotografie war einmal der sichtbare, bleibende Ausdruck des besonderen Moments, des Augenblicks, der sich als Gegenwelt behaupten musste gegenüber dem Alltag, in den sich das Besondere nicht integrieren ließ. Die Fotografie als eine der Realität versprochene Kunstform wird hier völlig dysfunktional: Madoz’ Fotografien sind ohne Titel, was an sich schon ein Paradox ist. Er sagt selbst, dass er vor seinen „Bildern stehen und fühlen möchte, dass ich mit ihnen kommunizieren kann.“ Diese Kommunikation – an Magritte und Man Ray geschult – kann man sich voller Humor vorstellen, in der das Imaginierte des Gedichts, das Unausgesprochene, visuell übersetzt wird. Denn nicht von ungefähr ist die Pik 5 beim Kartenlegen die Karte des Betrugs.
Karl Blossfelds (1865–1932) Kreise sind Blüten: Er hatte um 1900 damit begonnen, Vergrößerungen von Blättern anzufertigen, außerdem fotografierte er Stiele, Samen und Hülsen, um die Analogie von Natur- und künstlerischen Formen aufzuzeigen. Jenseits jeglicher naturwissenschaftlicher Dokumentationspflicht ist das Buch „Urformen der Kunst“ (1928), dem die Blätter entnommen wurden, vor allem durch die gewissenhafte Lichtführung, die Rahmung und Sequenzierung ausgezeichnet. Monatelang suchte Blossfeldt nach Pflanzen, die seiner formalen Vorstellung entsprachen, so dass man ihn zum ersten Vertreter einer ‚skulpturalen Fotografie’ zählen kann. Und so scheinen wir nicht auf Pflanzenteile zu blicken, sondern auf architektonische Details: Fialen, Schlusssteine, Konsolen, Brüstungen, Türknäufe, die in Holz oder Metall ausgeführt sein konnten, erinnern weniger an die Bauhausprinzipien als an die Architektur des Jugendstils. Blossfeldts Hang zur Halbabstraktion verbindet ihn mit den surrealen Fotografien von Chema Madoz, während die botanische Grundlage seiner Arbeiten mit den Collagen Dieter Hiesserers korrespondiert, wobei Leichtigkeit kein Darstellungsziel der Arbeiten war.
Wie eine installative Antwort auf Karl Blossfeldts Pflanzenstudien wirkt die Arbeit von Francesca Woodman (1958–1981), die verschiedene Reproduktionen von Vögeln auf einer Fotografie versammelt. Selbst ebenfalls ein aufzeichnendes Medium, ist die Fotografie nun eine weitere Stufe der Darstellbarkeit, die zwischen fixiert und gezeichnet, zwischen subjektiver Aneignung und mathematischer Präzision changiert.
Ihre Hand, ihr Schatten werden zum Teil der Arbeit, als gesichtsloser Gegenstand, als Teil des unpersönlichen Raumes und doch als Zeichen dafür, dass hier gezeigt wird, gezeigt werden soll und gleichzeitig die Grenze des Zeigens thematisiert wird.
Durch ein stetiges Schwanken zwischen An- und Abwesenheit, das sie und die Objekte selbst nie wirklich greifbar, aber immer zum Thema macht, zeigt sich ihre Nähe zu den fragilen Identitäten der surrealistischen Fotografien Claude Cahuns. Die Fotografie wird zum Schauplatz unheimlicher Erscheinungen: Was man dort sieht, ist niemals ganz lebendig, aber auch nie ganz tot.
Die Ausstellung deutet an, dass Kunst neben aller Politisierung das tun darf und soll, was sie am besten kann: auf das zu schauen zu hören, was andere als unsichtbar erachten, die unbeachteten Phänomene des Alltäglichen zu rhythmisieren und ihnen eine eigene Poesie zuzuerkennen. Auch eine Biene, so haben jüngste Untersuchungen nachgewiesen, kann das Konzept der Zahl Null verstehen.
Dr. Anja Schürmann